
Die Voraussage von de Broglie, dass alle Materieteilchen wellenähnliche Eigenschaften besitzen, wurde experimentell bestätigt. Es liegt daher nahe zu prüfen, ob Teilchen, z.B. Elektronen, auch Interferenz am Doppelspalt zeigen. Zum Vergleichen dienen die Doppelspaltversuche mit Teilchen und mit Wasserwellen, die im Abschnitt "Das Photon als Quantenobjekt" beschrieben wurden:
Doppelspaltversuch mit Teilchen:
N12: Verteilung der Teilchen bei zwei geöffneten Spalten
N1, N2: Verteilung der Teilchen bei jeweils nur einem geöffneten Spalt

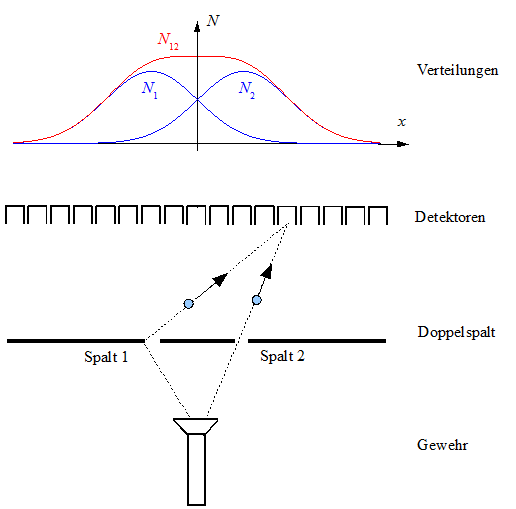
Doppelspaltversuch mit Wasserwellen:
I12: Intensität bei zwei geöffneten Spalten
I1, I2: Intensität bei jeweils nur einem geöffneten Spalt

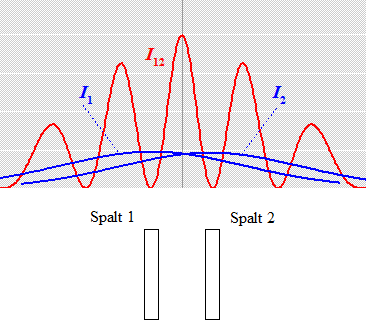
Dieser
Versuch wurde erstmals von Claus Jönsson durchgeführt.
Jönsson entwickelte Techniken zur Herstellung von
Kupferfolien
mit materiefreien Spalten. Ab 1959 gelang es ihm, Folien mit einem
Spaltabstand von  herzustellen. Eine solche Folie wurde mit Elektronen beschossen,
die
mit einer Spannung von 40 kV beschleunigt wurden. Der Abstand der
erwarteten Interferenzstreifen ergibt sich wie folgt:
herzustellen. Eine solche Folie wurde mit Elektronen beschossen,
die
mit einer Spannung von 40 kV beschleunigt wurden. Der Abstand der
erwarteten Interferenzstreifen ergibt sich wie folgt:
1) Bestimmung des Impulses der Elektronen:
Bei der Energie von 40 keV muss bereits relativistisch gerechnet werden. Dazu wird die Energie-Impuls-Relation angewendet:

Daraus folgt

2) Bestimmung der de-Broglie-Wellenlänge der Elektronen:

3) Abstand der Interferenzstreifen:
Der
Abstand vom Doppelspalt zur Beobachtungsebene betrug  .
Beim Doppelspalt gilt für das n-te Maximum bekanntlich
.
Beim Doppelspalt gilt für das n-te Maximum bekanntlich

Da die Winkel sehr klein sind, kann der Sinus des Winkels durch den Tangens ersetzt werden, der sich aus dem Abstand zn des Maximums n-ter Ordnung vom Hauptmaximum und dem Abstand l Spalt - Beobachtungsebene ergibt:

Für das Maximum (n + 1)-ter Ordnung gilt entsprechend:

Differenzbildung führt auf:

Der Abstand benachbarter Interferenzstreifen ist damit

4) Optischer Streifenabstand:
Das Interferenzmuster wurde elektronenoptisch 100fach vergrößert auf den Endleuchtschirm bzw. eine Fotoplatte gebracht und mit einer 10fach vergrößernden Einblickoptik betrachtet. Der optisch zu beobachtende Abstand zweier Interferenzstreifen betrug daher

Anfang 1959 gelang so die erste Abbildung des erwarteten elektronenoptischen Interferenzstreifensystems:

Mit besserer Messtechnik konnten später auch Belichtungsreihen mit steigender Belichtungszeit angefertigt werden, die den Aufbau des Interferenzmusters erkennbar werden ließen (z.B. Tonamura 1989).
Beobachtungen:
Jeweils ein Lichtblitz auf dem Detektorschirm zeigt eine Elektronenlokalisation an, das bedeutet: Elektronen kommen immer stückweise an.
Die Lichtblitze sind stets von gleicher Helligkeit, das bedeutet: Elektronen kommen immer im Ganzen an.
Bei einer geringeren Intensität der Elektronenkanone ergeben sich immer noch Lichtblitze derselben Helligkeit, nur weniger pro Zeiteinheit.
Nach hinreichend langer Zeit ergibt sich eine Verteilung der Elektronenlokalisationen gemäß des Intensitätsverlaufs bei der Interferenz von Wellen:

Bei jeweils nur einem geöffneten Spalt ergeben sich Verteilungen der Elektronenlokalisationen, die den Intensitätsverläufen I1 bzw. I2 von Wellen entsprechen.
In der Verteilung der Elektronenlokalisationen zeigt sich die ganze Eigentümlichkeit der Quantenmechanik: Es scheint so, als würden die Elektronen als Teilchen in der Elektronenkanone starten und als Teilchen im Detektor ankommen, doch ist die Verteilung der Elektronenlokalisationen dort so, als würden sich die Elektronen unterwegs als Wellen fortpflanzen und daher Interferenzeffekte zeigen. Photonen verhalten sich ebenso: Auch sie werden als Teilchen im Detektor nachgewiesen, und die Verteilung der Photonenlokalisationen ist dort so, als würden sie sich unterwegs als Wellen fortpflanzen. Die bei Photonen angestellten Überlegungen können daher auf Elektronen übertragen werden:
Die Interferenz ist mathematisch einfach zu beschreiben: Im Falle von Wellen, wie z.B. Wasserwellen, ergibt sich der Intensitätsverlauf einfach aus der Addition der jeweiligen Auslenkungen der beiden Wellen, die von Spalt 1 bzw. Spalt 2 ausgehen und zum Detektor gelangen. Die Intensität ist dann proportional zum Quadrat der resultierenden Amplitude. Analog kann die Interferenz beschrieben werden, die bei Elektronen am Doppelspalt beobachtet wird. Hier stellt sich sofort die Frage:
Was ist bei Elektronen die Wellengröße?
Wie
bei Photonen wird aus der Verteilung der Elektronenlokalisationen
eine Wahrscheinlichkeitsdichte gebildet: Wenn von N
Elektronen der Anteil Ni auf ein
Flächenelement
 des Detektorschirms
fällt, dann
ist
des Detektorschirms
fällt, dann
ist

die
Wahrscheinlichkeitsdichte auf dem Flächenelement  ein Elektron zu registrieren. Die Wellengröße ist daher
eine Wahrscheinlichkeitamplitude Ai. Das
Quadrat dieser Amplitude gibt die Verteilung der
Elektronenlokalisationen an, also die Wahrscheinlichkeitsdichte.
Wie
bei der Intensität von Wellen gilt dann für die
Wahrscheinlichkeitsdichte:
ein Elektron zu registrieren. Die Wellengröße ist daher
eine Wahrscheinlichkeitamplitude Ai. Das
Quadrat dieser Amplitude gibt die Verteilung der
Elektronenlokalisationen an, also die Wahrscheinlichkeitsdichte.
Wie
bei der Intensität von Wellen gilt dann für die
Wahrscheinlichkeitsdichte:

Was interferiert bei Elektronen am Doppelspalt?
Häufig wird gesagt: Ein Elektron interferiert mit sich selbst. Das ist jedoch nicht wörtlich zu nehmen. Elektronen werden beim Doppelspaltversuch und ähnlichen Versuchen immer als Ganzes nachgewiesen, sie teilen sich also nicht am Doppelspalt. Wie die Verteilungen P1 und P2 zeigen, geht ein Elektron stets durch genau einen der beiden Spalte. Sind beide Spalte geöffnet, hat ein Elektron zwei Möglichkeiten, durch den Doppelspalt zu gehen, und es ergibt sich das Interferenzmuster P12. Die Interferenz mit sich selbst ist daher besser als Interferenz der Möglichkeiten zu bezeichnen.
Ein solches Verhalten steht nicht im Einklang mit alltäglichen Erfahrungen, und es scheint sogar völlig unverständlich zu sein. Das ist es auch. Der US-amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard P. Feynman schrieb in der Einleitung einer Vorlesung zur Elektroneninterferenz am Doppelspalt:
"Bilden Sie sich nicht ein, Sie müssten das, was ich Ihnen beschreibe, in Begriffen eines anderen Modells verstehen; lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie. Denn ich beschreibe Ihnen jetzt das Verhalten der Natur, und wenn Sie es einfach als möglich akzeptieren, werden Sie von ihr ganz entzückt und hingerissen sein. Also fragen Sie nicht dauernd, wenn Sie es fertigbringen: 'Aber wie ist das denn möglich?' Das führt in eine Sackgasse, aus der noch keiner wieder herausgekommen ist. Niemand weiß, wieso es so sein kann, wie es ist." (R.P.Feynman: Vom Wesen physikalischer Gesetze)
Am Ende der Überlegungen stellt Feynman fest:
"Zusammenfassend kann man also sagen, die Elektronen kommen stückweise wie Teilchen, die Wahrscheinlichkeit dagegen, dass sie Stück für Stück eintreffen, wird auf eine Weise bestimmt, wie man die Intensitäten von Wellen berechnen würde. In diesem Sinne verhalten sich Elektronen manchmal wie Teilchen und manchmal wie Wellen. Sie verhalten sich gleichzeitig auf zwei verschiedene Arten und Weisen.
|
Kugeln kommen stückweise gemessen wird: Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
|
Wasserwellen können jede Größe haben
 |
Elektronen (Photonen) kommen stückweise
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
|
Mehr
lässt sich dazu nicht sagen." (ebd.)
Gehen Sie im Internet auf die Seite
http://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/doppelspalt/index.html
Laden Sie sich von dort die Datei "doppelspalt.zip" auf ihren Rechner. Danach können Sie die Verbindung zum Internet trennen.
Extrahieren
Siedie zip-Datei. Dabei wird ein Verzeichnis "Doppelspalt"
auf Ihrem Rechner angelegt.
In diesem Verzeichnis finden Sie die
ausführbare Datei "Lehrgang.bat". Mit einem
Doppelklick starten Sie das Programm im Lehrgangsmodus.
Öffnen Sie zunächst das Menü "Lehrgang" und machen Sie sich mit dem Programm vertraut.
Wenn Sie sich in das Programm eingearbeitet haben, können Sie es auch durch Doppelklick auf die Datei "doppelspalt.exe" starten. Dann wird das Menü "Lehrgang" jedoch nicht angeboten.